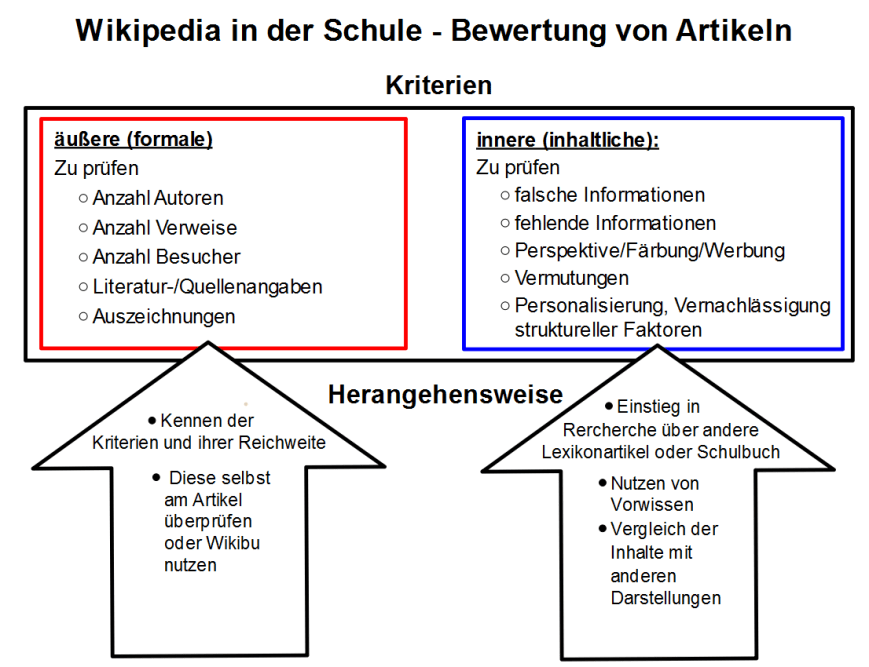Der Flipped Classroom scheint auch in Deutschland angekommen zu sein, zumindest in den Medien, darauf hat Christoph Pallaske vor kurzem noch hingewiesen, wenn auch noch offensichtlich weiterhin weniger bei den Lehrkräften an den Schulen (siehe z.B. die kleine Zahl der im deutschen ICM-Netwerk registrierten).
Über die Gründe, warum das so ist, lässt sich lange diskutieren (siehe z.B. hier auf Google+). In ihrem gut lesbaren Buch erzählen die beiden „Pioniere“ Jonathan Bergmann und Aaron Sams in einem angenehmen kollegialen Gesprächston, wie sie zum „Flipped Classroom“ gekommen sind, was ihre Ausgangsbasis war („We both started teaching […] using the traditional lecture method“, S. 103), wie sie ihr Konzept nach und nach (weiter-) entwickelt haben und sie geben praktische Tipps für alle, die das Konzept selbst ausprobieren wollen.
In dem Buch findet sich nichts, was sich nicht auch im Netz in verschiedenen Blogs oder Zeitungsberichten nachlesen ließe. Einen guten Überblick zum Einstieg bietet auch das von Dan Spencer zusammengestellte Google Doc. Der Vorteil des Buches liegt in seiner kompakten Zusammenstellung. Spannend und zugleich motivierend zu lesen ist, wie das Konzept schrittweise entwickelt wurde, wobei die Autoren auch ihre Fehler und Irrwege beschreiben und was sie daraus gelernt haben. Wer Interesse hat, selbst den „flipped classroom“ im Unterricht auszuprobieren, wird mit dem Buch sicher eine gute Grundlage haben, um das ein oder andere Problem bei der Umsetzung zu vermeiden.
Ihr Vorgehen resultierte ohne Rückgriffe auf Literatur und bestehende Unterrichtskonzepte. Das ist einigermaßen unbekümmert, und vielleicht auch naiv zu nennen, hat aber durch das vermutlich glückliche Zusammentreffen engangierter Lehrer in der US-amerikanischen Provinz zu einer eigenständigen Entwicklung geführt, bei der die Autoren erst im Nachhinein die großen Schnittmengen und Ähnlichkeiten zu anderen Konzepten wie z.B. dem Projektlernen, Offenen Unterricht und Blended Learning entdeckt haben. Entsprechend kommt der schmale Band völlig ohne Fußnoten oder sonstige Referenzen daher und belegt seine Thesen durch Erfahrungsberichte, oft in Form exemplarischer Anekdoten.
Bei der Rezeption des Konzepts und seiner Popularisierung wurde es wiederholt auf den Einsatz von selbst produzierten, online verfügbaren Unterrichtsvideos reduziert (vor allem auch durch die Selbstdarstellung der bekannten Khan-Academy – siehe dazu auch hier). Die Autoren werden nicht müde zu wiederholen, dass es nicht um Videos geht, die zwar für sie den Ausgangspunkt bildeten und durch die Internetpräsenz auch massiv zur Verbreitung beigetragen haben, aber nicht den Kern des Konzepts darstellen.
Es ging ihnen darum, Unterricht zu personalisieren, als Lehrer mehr Zeit für den einzelnen Lernenden zu haben, diese individuell und damit differenziert zu fördern und sie aus der passiven Rolle in eine aktive zu versetzen, in der die Lernenden selbst für ihren Lernprozess verantwortlich sind. Die Autoren sind sich bewusst, nichts weltbewegend Neues erfunden zu haben:
We do not claim to have invented some new pedagogy, and we have not tried to brand an innovation. (S. 111)
Ein erfrischend ehrliches Statement angesichts des Hypes, das um den Flipped Classroom entstanden ist und den Ton des gesamten Buches gut trifft. Weg von den so stark fokussierten Videos liegt der Ausgangspunkt für den Flipped Classroom in einer zentralen Frage:
Which activities that do not require my physical presence [as a teacher] can be shifted out of class in order to give more class time to activities that are enhanced by my presence? (S. 96)
Ziel ist es, die Lernenden in der gemeinsamen Zeit in der Schule individuell anzusprechen und ihnen dort zu helfen, wo sie Probleme haben. Wenig überraschend ist dann auch die Beschreibung der veränderten Lehrerrolle, die Bergmann und Sams als „role of a supportive coach“ (S. 71) skizzieren.
Die Videos sind dabei nur ein Material neben vielen anderen. Ebenso erfolgt eine Öffnung für unterschiedliche Ausdruckformen der Lernenden, die ihren Lernprozess und die Ergebnisse schriftlich, mündlich, als Video, Podcast oder in Form eines Blogs dokumentieren. Die digitalen Medien erweitern die Möglichkeiten enorm sowohl in der Verfügbarkeit von Informationen als auch in der Dokumentation und Darstellung. Daher ist es kein Zufall, dass das Konzept in den letzten Jahren entstanden ist. Das schließt, wie selbstverständlich angesichts der Ausstattungsituation der Schulen, die Idee des BYOD (Bring your own device) mit ein, ohne dass diese so genannt wird:
The sad thing is that most students are carrying in their pockets a more powerful computing device than the vast majority of computers in our underfunded schools – and we don’t allow them to use it. […] We encourage our students to bringin their own electronic equipement because, frankly, it is better than our school’s antiquated technology. (S. 20f.)
Das dürfte auf die Situation in den meisten deutschen Schulen ebenso zutreffen. Natürlich wissen die Autoren um die Probleme. Ihren Kritikern halten sie entgegen, dass es Aufgabe von Schule und Lehrkraft ist, eine gleich faire Lernumgebung für alle anzubieten:
Those interested in education technology must do everything in their power to bridge the digital divide. (S. 97)
Das ist im übrigen günstiger, weil nur Lücken gefüllt werden, als der Versuch der Vollausstattung von Schulen mit Computerräumen oder Laptops, die zudem schnell veralten und oft schlecht geflegt werden.
Ingesamt grundlegend scheint folgende Aussage:
Allowing the students choice in how to learn has empowered them. […] we give them the ownership of their learning. (S. 67f.)
Das beschreiben Bergmann und Sams zugleich als einen der schwierigsten Prozesse für erfahrene Lehrkräfte: die Verantwortung an die Schüler abzugeben. Und zugleich wissen sie, dass einigen ihr Ansatz hierbei nicht weit genug geht:
Strong constructivists and die-hard project-based learning advocates will say the we have not gone far enough in handing over the learning to our students. (S. 111)
Ich denke, genau hier liegt aber auch eine Erklärung, warum der Flipped Classroom so schnell Verbreitung findet. Das Konzept ermöglicht mit Hilfe von digitalen Medien eine Differenzierung und Individualisierung von Unterricht, wie sie seit Jahrzehnten gefordert wird, aber kaum Umsetzung erfahren hat. Der Flipped Classroom bietet Lehrern ein Modell zu einer schrittweisen Öffnung ihres Unterrichts, das ihm Rahmen des eigenen Unterrichts, der bestehenden Stundentafeln und des gegenwärtigen Gesamtsystems Schule funktioniert.
Bergmann und Sams weisen zurecht darauf hin, dass der Flipped Classroom bisher nicht wissenschaftlich evaluiert ist und daher ihre Beschreibung höchst subjektiv ist. Aus der Praxis können beide eben nur sagen, dass das Modell in ihrem Unterricht funktioniert. Der Flipped Classroom ist somit nur ein Konzept neben anderen und es ist wichtig, jeweils zu überlegen, wo und wie, für welche Inhalte und Kompetenzen, mit welcher Lerngruppe usw. es sinnvoll eingesetzt werden kann. Methodische Abwechslung bleibt grundlegend und das Verkehrteste wäre daraus eine Ideologie zu machen, wie Unterricht abzulaufen hat.
Wer methodische Alternativen sucht und seinen Unterricht öffnen will, dem bietet der Flipped Classroom ein ebenso hilfreiches wie einfaches Modell, das sich lohnt im Unterricht auszuprobieren, sofern man bereit ist die tradierte Lehrerrolle zu verlassen und den Lernenden Verantwortung zu übertragen:
[…] flipping the classroom is an easy step that any teacher can take a move away from the in-class direct instruction to more student-directed and inquiry-based learning. (S. 111)
—
Jonathan Bergmann / Aaron Sams, Flip your classroom: reach every student in every class every day, ISTE, Eugene/Washington D.C. 2012.